|

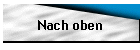
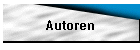

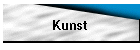
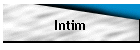
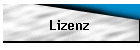
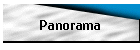

Home
Übersicht

| |
|
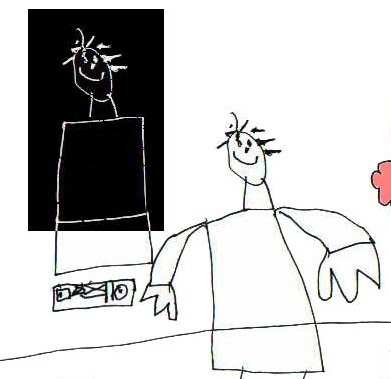
|
Bild
und Recht
Einige
urheberrechtliche Probleme bei Bildern, Abbildungen, Fotos, Grafiken etc.
Caroline-Entscheidung
Recht am eigenen Bild
|
| Dieses Gebiet ist längst nicht
juristisch "festgesteckt", mit anderen Worten: im Fall von Auseinandersetzungen
kann man mit Überraschungen der Rechtsprechung jederzeit rechnen. Die Darstellung im
folgenden hat daher nur einen sehr bedingten Orientierungswert und erhebt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. |
| Was gilt eigentlich für den
Urheberrechtsschutz mehr oder weniger alter Meister? Die Nutzung der Rechte an Werken von
Kunst und Kultur ist eigentlich durch das Urheberrecht geregelt, das selbstständige
kreative Leistungen schützen will: Zu Lebzeiten verfügt der Künstler selbst über die
Rechte an seinem Werk und kann sie gegen ein Honorar beispielsweise an einen Verlag
abtreten. Gemäß § 64 UrhG erlöschen bei Kunstwerken die Urheberrechte 70 Jahre
nach dem Tod des Urhebers. Während eines Zeitraums von bis zu 70 Jahren nach seinem
Tod geht dieses Recht auf seine Erben über. Danach werden die Werke gemeinfrei.
Jeder kann sie dann nach Belieben reproduzieren und die Reproduktionen verkaufen. Aber
Vorsicht: Für die Reproduktion der alten Gemälde werden zumeist neue Fotos angefertigt,
die ebenfalls geschützt sein können.
Merke: Es gibt zwei Arten von Fotografien:
1.
Lichtbildwerke, die hohe Kunst also, die 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen geschützt
sind,
2. einfache Lichtbilder, die 50 Jahre nach Erscheinen bzw. Herstellung geschützt
sind.
Nach § 72 UrhG sind einfache Lichtbilder also 50 Jahre
lang nach dem Erscheinen bzw. der Herstellung geschützt. Der fotografische
Leistungsschutz gilt nach allerdings § 72 UrhG nicht für Lichtbilder, die lediglich für
die originalgetreue Reproduktion zweidimensionaler Vorlagen (Gemälde, Zeichnungen etc.)
hergestellt werden.
So
lautet das Gesetz:
(1) Lichtbilder und
Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, werden in entsprechender
Anwendung der für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 geschützt.
(2) Das Recht nach Absatz 1
steht dem Lichtbildner zu.
(3) Das Recht nach Absatz 1
erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn seine erste
erlaubte öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig
Jahre nach der Herstellung, wenn das Lichtbild innerhalb dieser Frist nicht erschienen
oder erlaubterweise öffentlich wiedergegeben worden ist. Die Frist ist nach § 69 zu
berechnen.
Die Rechtsprechung verlangt für den Schutz nach § 72 UrhG
ein Mindestmaß an persönlicher Gestaltung. Für Fotos, die für die Reproduktion anderer
Fotos hergestellt werden, hat der BGH (GRUR 1990, 669 ff. ) entschieden: Die
fotografisch hergestellte Kopie eines vorhandenen Fotos ist nicht selbständig
schutzfähig. Andernfalls könnte durch wiederholte fotografische Reproduktionsvorgänge
die Schutzfrist eines Bildes beliebig verlängert werden.
|
| Es gibt den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts,
der den markenrechtlichen Raubbau an gemeinfreien Werken zumindest eindämmt. Das
weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, das seit langem gemeinfrei, d. h. nicht mehr
urheberrechtlich geschützt ist, durfte danach nicht originalgetreu als Bildmarke
eingetragen werden. Die Eintragung von Leonardo da Vincis weltberühmten Gemäldes
"Mona Lisa" scheiterte beim Bundespatentgericht wegen seines vielfältigen
Einsatzes als Werbemotiv, weshalb ein Bezug zu einem bestimmten Anmelder fern läge.
|
| Vgl.
auch BGH - I ZR 55/97 Urteil v. 3. November 1999 Auszug aus den Gründen:
Die
Frage, welche Schutzvoraussetzungen im Zeitpunkt der behaupteten Verletzungshandlungen
für Lichtbildwerke gegolten haben, kann jedoch offen bleiben, weil die benutzten
Fotografien jedenfalls als Lichtbilder im Sinne des § 72 UrhG geschützt sind. Für den
Lichtbildschutz ist kein eigenschöpferisches Schaffen im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG
erforderlich; es genügt vielmehr ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung, wie
es in der Regel schon bei einfachen Fotografien gegeben ist (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 -
I ZR 14/88, GRUR 1990, 669, 673 - Bibelreproduktion; Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89,
GRUR 1993, 34, 35 = WRP 1992, 160 - Bedienungsanweisung). Gemessen daran ist auch den in
den Werbeanzeigen enthaltenen Porträtfotos der Schutz des § 72 UrhG nicht abzusprechen. |
 |
Caroline-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (24.06.2004) zur Frage des Schutzes vor
Bildveröffentlichungen |
 In einem Grundsatzurteil vom
15. Dezember 1999 hat das Bundesverfassungsgericht (Abbildung links) die Veröffentlichung bestimmter
Fotos, auf denen die Beschwerdeführerin, Prinzessin Caroline von Hannover, mit ihren
Kindern zu sehen ist, untersagt, da Kinder in höherem Maße des Schutzes bedürften als
Erwachsene. Das Verfassungsgericht befand allerdings, dass die Beschwerdeführerin, die
unzweifelhaft eine ,,absolute Person der
Zeitgeschichte" sei, die Veröffentlichung von Fotografien hinnehmen
müsse, die sie in der Öffentlichkeit zeigen, selbst wenn die Bilder eher ihr
Alltagsleben betreffen als die Erfüllung ihrer offiziellen Pflichten. Das Gericht verwies
in diesem Zusammenhang auf die Pressefreiheit
und auf das legitime Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, wie sich eine solche
Persönlichkeit allgemein im öffentlichen Leben verhält. Die Beschwerdeführerin macht
geltend, die Entscheidungen der deutschen Gerichte würden gegen ihr Recht auf Achtung
ihres Privatlebens verstoßen; denn die Gerichte hätten ihr keinen angemessenen Schutz
vor der Veröffentlichung von Fotos gewährt, die Sensationsreporter von ihr ohne ihr
Wissen gemacht haben, weil sie aufgrund ihrer Herkunft unzweifelhaft eine ,,absolute
Person der Zeitgeschichte" sei. Ferner liege eine Verletzung ihres Rechts auf Achtung
ihres Familienlebens vor. Die Beschwerdeführerin beruft sich dabei auf Artikel 8 (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention. In einem Grundsatzurteil vom
15. Dezember 1999 hat das Bundesverfassungsgericht (Abbildung links) die Veröffentlichung bestimmter
Fotos, auf denen die Beschwerdeführerin, Prinzessin Caroline von Hannover, mit ihren
Kindern zu sehen ist, untersagt, da Kinder in höherem Maße des Schutzes bedürften als
Erwachsene. Das Verfassungsgericht befand allerdings, dass die Beschwerdeführerin, die
unzweifelhaft eine ,,absolute Person der
Zeitgeschichte" sei, die Veröffentlichung von Fotografien hinnehmen
müsse, die sie in der Öffentlichkeit zeigen, selbst wenn die Bilder eher ihr
Alltagsleben betreffen als die Erfüllung ihrer offiziellen Pflichten. Das Gericht verwies
in diesem Zusammenhang auf die Pressefreiheit
und auf das legitime Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, wie sich eine solche
Persönlichkeit allgemein im öffentlichen Leben verhält. Die Beschwerdeführerin macht
geltend, die Entscheidungen der deutschen Gerichte würden gegen ihr Recht auf Achtung
ihres Privatlebens verstoßen; denn die Gerichte hätten ihr keinen angemessenen Schutz
vor der Veröffentlichung von Fotos gewährt, die Sensationsreporter von ihr ohne ihr
Wissen gemacht haben, weil sie aufgrund ihrer Herkunft unzweifelhaft eine ,,absolute
Person der Zeitgeschichte" sei. Ferner liege eine Verletzung ihres Rechts auf Achtung
ihres Familienlebens vor. Die Beschwerdeführerin beruft sich dabei auf Artikel 8 (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention. |
|
Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hält als Erstes fest,
dass einige Fotografien, auf denen die Beschwerdeführerin mit ihren Kindern zu sehen ist,
sowie das Foto, das sie in Begleitung eines Schauspielers hinten im Hof eines Restaurants
zeigt, nicht länger Gegenstand des Rechtsstreits sind. Der Bundesgerichtshof hat nämlich
jede weitere Veröffentlichung dieser Fotos untersagt, da durch sie das Recht der
Beschwerdeführerin auf Achtung ihres Familienlebens verletzt werde.
Es steht außer
Zweifel, dass die von verschiedenen deutschen Zeitschriften veröffentlichten Fotos, auf
denen die Beschwerdeführerin allein oder mit anderen Personen im Rahmen ihres
Alltagslebens zu sehen ist, ihr Privatleben berühren. Artikel
8 der Konvention ist daher in diesem Fall anwendbar. Es ist somit eine
Abwägung zwischen dem Schutz des Privatlebens, auf den die Beschwerdeführerin Anspruch
hat, und der durch Artikel 10 der Konvention garantierten Freiheit der Meinungsäußerung
vorzunehmen.
Die Freiheit der
Meinungsäußerung gilt zwar auch für die Veröffentlichung von Fotos, doch in diesem
Bereich kommt dem Schutz des guten Rufs und der Rechte anderer besondere Bedeutung zu, da
es hier nicht um die Verbreitung von „Ideen“ geht, sondern von Bildern, die sehr
persönliche oder sogar intime Informationen über einen Menschen enthalten. Außerdem
werden die in der Boulevardpresse veröffentlichten Fotos oftmals unter Bedingungen
gemacht, die einer ständigen Belästigung gleichkommen und von der betroffenen Person als
Eindringen in ihr Privatleben, wenn nicht sogar als Verfolgung empfunden werden.
Das entscheidende
Kriterium für die Abwägung zwischen Schutz des Privatlebens einerseits und Freiheit der
Meinungsäußerung andererseits besteht nach Ansicht des Gerichtshof darin, inwieweit die
veröffentlichten Fotos zu einer Debatte beitragen, für die ein Allgemeininteresse
geltend gemacht werden kann. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Fotos aus dem
Alltagsleben von Caroline von Hannover, um Fotos
also, die sie bei rein privaten Tätigkeiten
zeigen. Der Gerichtshof nimmt diesbezüglich zur Kenntnis, in welchem Zusammenhang die
Fotos gemacht wurden, nämlich ohne Wissen der Beschwerdeführerin, ohne ihre Einwilligung
und zuweilen auch heimlich. Diese Fotos können nicht als Beitrag zu einer Debatte von
allgemeinem öffentlichem Interesse angesehen werden, da die Beschwerdeführerin dabei
kein öffentliches Amt ausübt und die strittigen Fotos und Artikel ausschließlich
Einzelheiten ihres Privatlebens betreffen.
Ferner mag die
Öffentlichkeit zwar ein Recht darauf haben, informiert zu werden, ein Recht, das sich
unter besonderen Umständen auch auf das Privatleben von Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens erstrecken kann, im vorliegenden Fall ist ein solches Recht jedoch
nicht gegeben. Nach Auffassung des Gerichtshofs kann die Öffentlichkeit kein legitimes Interesse daran geltend machen zu
erfahren, wo Caroline von Hannover sich aufhält und wie sie sich allgemein in ihrem
Privatleben verhält, auch wenn sie sich an Orte begibt, die nicht immer als abgeschieden
bezeichnet werden können, und auch wenn sie eine weithin bekannte Persönlichkeit ist.
Und selbst wenn ein solches Interesse der Öffentlichkeit besteht, ebenso wie ein
kommerzielles Interesse der Zeitschriften, die die Fotos und die Artikel veröffentlichen,
so haben diese Interessen nach Ansicht des Gerichtshofs im vorliegenden Fall hinter dem
Recht der Beschwerdeführerin auf wirksamen Schutz ihres Privatlebens zurückzutreten. Der
Gerichtshof weist darauf hin, welche grundlegende Bedeutung dem Schutz des Privatlebens
für die Selbstentfaltung jedes Einzelnen zukommt, und hält fest, dass jede Person, auch
wenn es sich um eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens handelt, die „legitime
Erwartung“ hegen darf, dass ihr Privatleben geschützt und geachtet wird. Die von den
innerstaatlichen Gerichten aufgestellten Kriterien zur Unterscheidung zwischen einer
„absoluten“ Person der Zeitgeschichte und einer „relativen“ Person
reichen nach Ansicht des Gerichtshofs nicht aus, um einen wirksamen Schutz des
Privatlebens der Beschwerdeführerin zu gewährleisten, und es hätte anerkannt werden
müssen, dass die Beschwerdeführerin unter den gegebenen Umständen die „legitime Erwartung“ geltend machen
darf, dass ihr Privatleben geschützt wird.
Angesichts dessen
gelangt der Gerichtshof, trotz des Ermessensspielraums des Staates auf diesem Gebiet, zu
dem Schluss, dass die deutschen Gerichte die
widerstreitenden Interessen nicht in gerechter Weise gegeneinander abgewogen
haben. Somit befindet der Gerichtshof, dass Artikel 8 der Konvention verletzt worden ist
und dass über den Beschwerdepunkt, den die Beschwerdeführerin in Bezug auf ihr Recht auf
Achtung ihres Familienlebens vorgebracht hat, nicht entschieden zu werden braucht.
|
| Thema
Nutzungseinräumung bei Fotografien - vgl. den Fall "SPIEGEL CD-ROM"
- BGH, Urt. v. 5.7.2001 – I ZR 311/98 (OLG Hamburg):
Hat ein Fotograf einer Zeitschrift das
Recht eingeräumt, eine seiner Fotografien abzudrucken, erstreckt sich
diese Nutzungsrechtseinräumung nicht
auf eine später erschienene CD-ROM-Ausgabe der Jahrgangsbände der
Zeitschrift.
Ist die erforderliche Zustimmung zu einer
solchen CD-ROM-Ausgabe nicht eingeholt worden, kann der Fotograf mit Hilfe
des Unterlassungsanspruchs gegen die ungenehmigte Verwertung seiner Werke
oder Leistungen vorgehen. Dem steht nicht der Einwand der unzulässigen
Rechtsausübung entgegen, auch wenn der Fotograf aufgrund vertraglicher
Treuepflichten bei rechtzeitiger Anfrage verpflichtet gewesen wäre, einer
Nutzung seiner Fotografien im Rahmen der CD-ROM-Ausgabe zuzustimmen.
Wird der Verletzer auf Ersatz des im Wege
der Lizenzanalogie berechneten Schadens in Anspruch genommen, führt die
Zahlung nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags und damit auch nicht zur
Einräumung eines Nutzungsrechts.
|
|
Versteckte
Bildmanipulationen auch bei satirischen Darstellungen unzulässig
Die
Verbreitung eines veränderten Fotos eines Menschen verletzt das
allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten, wenn die Veränderungen
nicht als solche wahrgenommen werden (Bundesverfassungsgericht - Beschluss
vom 14.02.2005; Az.: 1 BvR 240/04). 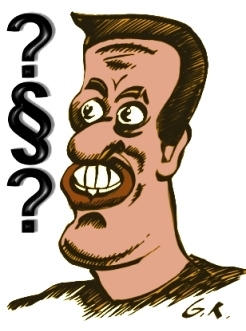 Auch in satirischen Zusammenhängen
ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eine versteckte
Manipulation nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Das Gericht
gab
damit der Verfassungsbeschwerde des früheren Telekom-Chefs Ron Sommer
statt und verwies die Sache zurück an den Bundesgerichtshof. Denn ein
Foto suggeriere für den Betrachter die Authentizität der Darstellung.
Dies gelte auch dann, wenn das Bild in satirischem Kontext verwendet werde
und die Darstellung im Übrigen erkennbar fiktiven Charakter habe. Auch in satirischen Zusammenhängen
ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eine versteckte
Manipulation nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Das Gericht
gab
damit der Verfassungsbeschwerde des früheren Telekom-Chefs Ron Sommer
statt und verwies die Sache zurück an den Bundesgerichtshof. Denn ein
Foto suggeriere für den Betrachter die Authentizität der Darstellung.
Dies gelte auch dann, wenn das Bild in satirischem Kontext verwendet werde
und die Darstellung im Übrigen erkennbar fiktiven Charakter habe.
Wenn
der manipulierte Bildteil eine eigenständige Aussage enthalte, müsse
dessen Aussage gesondert und vom satirischen Hintergrund getrennt
betrachtet werden.
In dem Fall erkannte das Gericht die Aussage darin, es
werde das wahre Aussehen des Abgebildeten wiedergegeben. Daher müsse auch
der kleine Bildausschnitt am Maßstab des Persönlichkeitsrechts gemessen
werden. Die in der bildhaften Darstellung in der Regel enthaltene
Tatsachenbehauptung über das Aussehen des Abgebildeten werde jedenfalls
unzutreffend, wenn das Foto über rein reproduktionstechnisch bedingte und
für den Aussagegehalt unbedeutende Veränderungen hinaus manipuliert
werde. Denn unrichtige Informationen unterfallen nicht dem Schutz der
Meinungsfreiheit. Dies gilt selbst für versteckte Veränderungen bei
einer Verwendung in satirischem Kontext. Der Kopf des Telekom-Chefs
Managers wurde in der konkreten Abbildung auf den Körper eines Mannes
montiert, der auf einem bröckelnden magentafarbenen «T» saß. Dabei war
auch Sommers Kopf um 5 Prozent gestreckt worden. Sommer klagte, weil er
die negative Veränderung seiner Gesichtsproportionen nicht hinnehmen
wollte. Während er in den ersten Instanzen erfolgreich war, wies der
Bundesgerichtshof die Klage schließlich ab. Der Bundesgerichtshof stellte
im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht darauf ab, dass eine satirische
Bildaussage ganzheitlich zu erfassen und das Gesicht als Bildbestandteil
nicht gesondert zu berücksichtigen sei.
|
| Rechtswidrig
hergestellte Fotos
Wurde eine Mieterin auf ihrer Terrasse ohne ihr Wissen
fotografiert, so hat sie gegen den Vermieter aus mietvertraglicher
Nebenpflicht Anspruch auf Auskunft darüber, von wem der Vermieter die
Fotos erhalten hat. Sie wird damit in die Lage versetzt, gegenüber dem
Weiterleiter der Fotos ebenso Ansprüche geltend zu machen wie gegenüber
etwa weiter dahinter stehenden Personen, zu denen sie sich erst durch
weitere Auskunftsklagen Zugang verschaffen müsste (LG Bonn, Urteil
15.12.2005, Az. 6 S 235/05). |
|

Zurück
zum Urheberrecht |
Top   |
|